Vorhaben der Registermodernisierung
Die Registermodernisierung ist Grundvoraussetzung für eine zukunftsfähige, effiziente und bürokratiearme deutsche Verwaltung. Mit dem "Gesetz zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisierungsgesetz – RegMoG)" wurde im April 2021 die Rechtsgrundlage dafür geschaffen. Der Kern des RegMoG ist Artikel 1 "Gesetz zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung (Identifikationsnummerngesetz – IDNrG)". § 1 des IDNrG definiert die Ziele des Gesetzes: Eine Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung als zusätzliches Ordnungsmerkmal in Register des Bundes und der Länder einzuführen, um
- Daten einer natürlichen Person in einem Verwaltungsverfahren eindeutig zuzuordnen,
- die Datenqualität der zu einer natürlichen Person gespeicherten Daten zu verbessern sowie
- die erneute Beibringung von bei öffentlichen Stellen bereits vorhandenen Daten durch die betroffene Person zu verringern.
Das Once Only-Prinzip
Die Ziele der Registermodernisierung werden erreicht, indem das sogenannte Once Only-Prinzip für Verwaltungsleistungen umgesetzt wird. Nach diesem Prinzip sollen staatliche Stellen Daten und Nachweise, welche bereits in einzelnen Registern vorliegen, selbst abrufen – das Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger vorausgesetzt. Bei Anträgen müssen nur noch neue Angaben oder Veränderungen übermittelt werden. Dies entlastet Bürgerinnen und Bürger, Behörden und verkürzt Bearbeitungszeiten in der Verwaltung.
Verwaltungen profitieren von vernetzten Registern durch verlässliche Daten, sowie einen vereinfachten und sicheren Austausch. So ist in den einzelnen Registern eine hohe Qualität der Daten in den einzelnen Registern sichergestellt, indem Inkonsistenzen und Redundanzen vermindert und Personenverwechslungen vermieden werden. Langfristig sind so auch nachweisfreie Verwaltungsleistungen möglich. Dies verkürzt Bearbeitungszeiten, spart Kosten und reduziert den Verwaltungsaufwand.
Auch das Onlinezugangsgesetz (OZG) zielt auf die Umsetzung des Once Only-Prinzips ab. Mit dem Gesetz wird für Bund und Länder die Grundlage geschaffen, ihre Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger auch digital anzubieten. In seiner finalen Stufe (Reifegrad 4) sieht das OZG vor, dass Verwaltungsleistungen datensparsam und bürokratiearm abgewickelt werden können und Nachweisabrufe gemäß dem Once Only-Prinzip gestaltet werden.
Identifikationsnummerngesetz listet 51 zu modernisierende Register
Von insgesamt mehr als 375 Registern wurden im IDNrG 51 Register benannt, die für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) eine vorrangige Rolle spielen. Die betroffenen Register sind in der Anlage 1 zu § 1 IDNrG aufgeführt:
Diese 19 Register werden zuerst modernisiert
Auf Basis von Nutzerpotenzialen für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wurden 19 Top-Register identifiziert. Durch die Priorisierung der Modernisierung dieser Register können spürbare Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie öffentlichen Stellen schnell realisiert werden. Die Top-Register wurden vom IT-Planungsrat (Beschluss 2021/05 sowie 2022/09) und der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen.
Inhalte und Bereitstellung der Identifikationsnummer
Um digitale Serviceangebote von Beantragung einer Verwaltungsleistung bis zur Ausstellung des Bescheides zu schaffen, müssen antragstellende Personen in den Registern mithilfe einer Identifikationsnummer (IDNr) eindeutig identifiziert werden (§ 2 Nr. 1 IDNrG). Hierfür wird auf bereits vorhandene Strukturen aufgesetzt, indem für Bürgerinnen und Bürger die sogenannte Steuer-Identifikationsnummer als registerübergreifendes und einheitliches Identifikationsmerkmal eingeführt wird.
Bei der IDNr handelt es sich um ein sogenanntes nicht-sprechendes Identifikationsmerkmal. Nicht-sprechend bedeutet, dass die Identifikationsnummer zufällig erzeugt wird, keine Informationen über Bürgerinnen und Bürger enthält und somit keine Rückschlüsse auf die Identität einzelner Personen zulässt.
Neben der Identifikationsnummer werden demäß § 4 Abs 1 IDNrG personenbezogene Daten gespeichert, die für die Identifikation einer natürlichen Person erforderlich sind. Mit modernisierten Registern ist eine technische Infrastruktur etabliert, mit der die Qualität der Basisdaten kontinuierlich gewährleistet wird.
Folgende personenbezogene Daten sind nach IDNrG sogenannte Basisdaten:
Anforderungen an die Kommunen
Hier finden Sie Informationen zu Anforderungen an Kommunen.
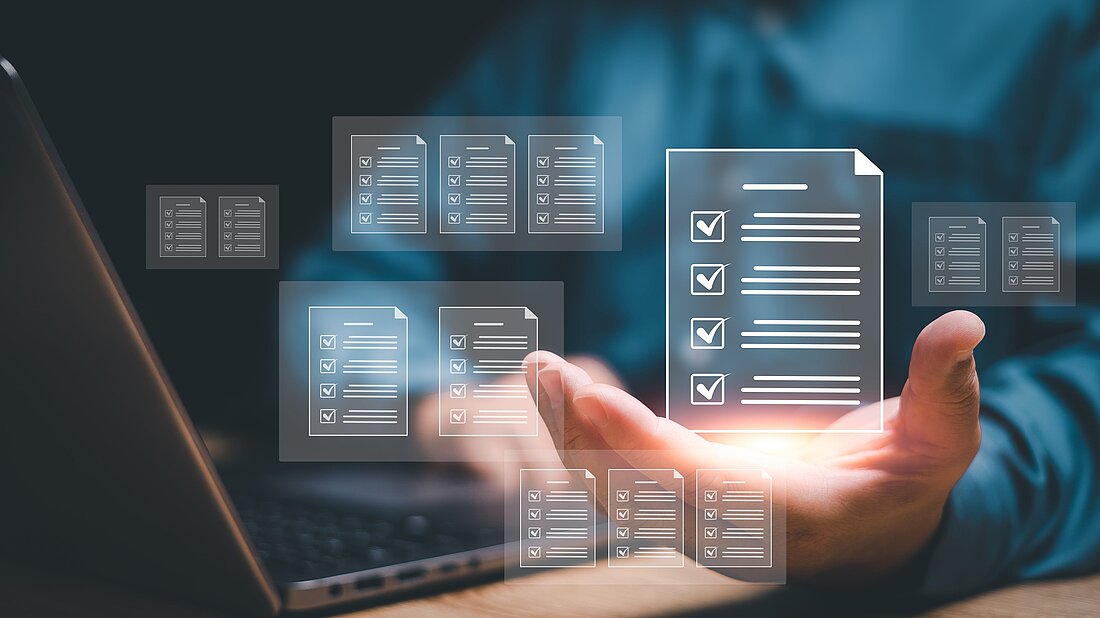
Vorteile der Registermodernisierung
Hier finden Sie einen Überblick der Vorteile modernisierter Register für Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger.

Gesamtzeitplan der Registermodernisierung
Hier finden Sie weitere Informationen zum Gesamtzeitplan der Registermodernisierung.
